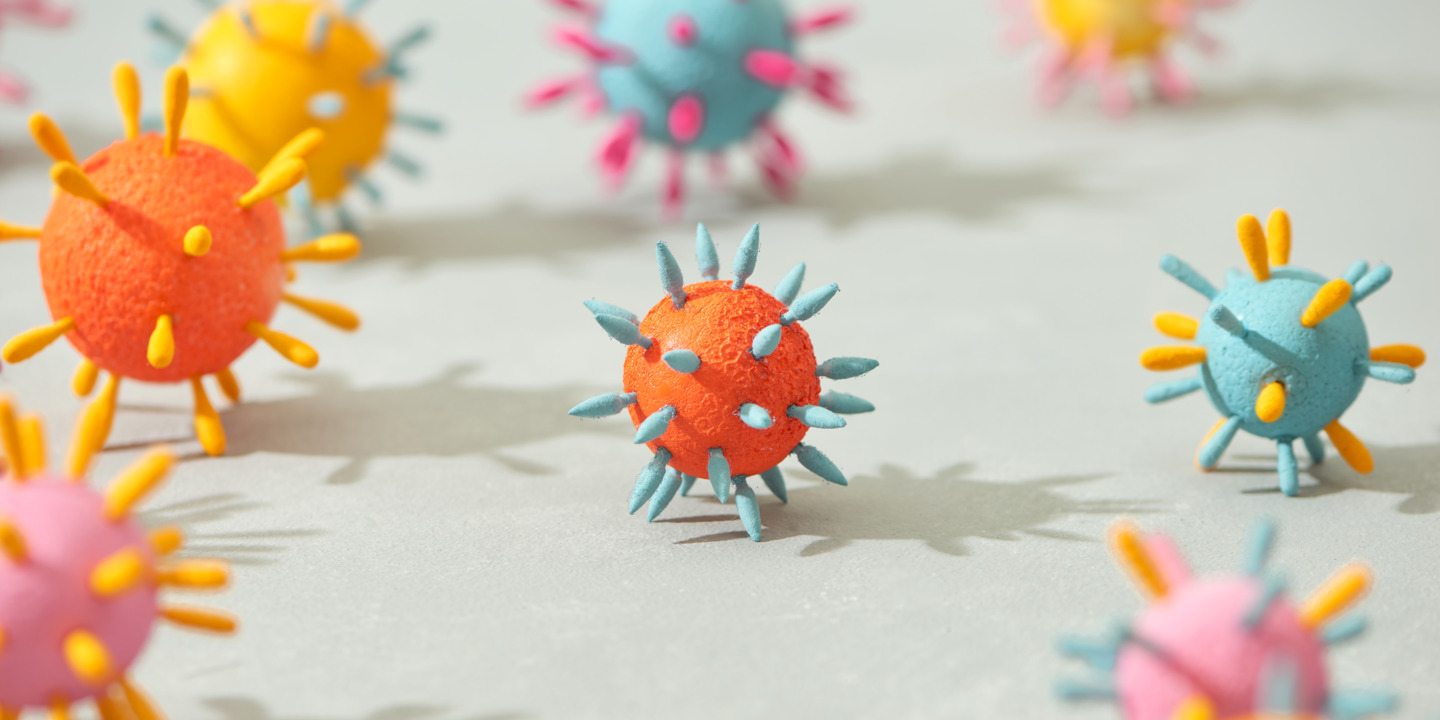
Inkubationszeit
Die Inkubationszeit – der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen – beträgt meist ein bis 14 Tage. Im Durchschnitt sind es fünf bis sechs Tage.
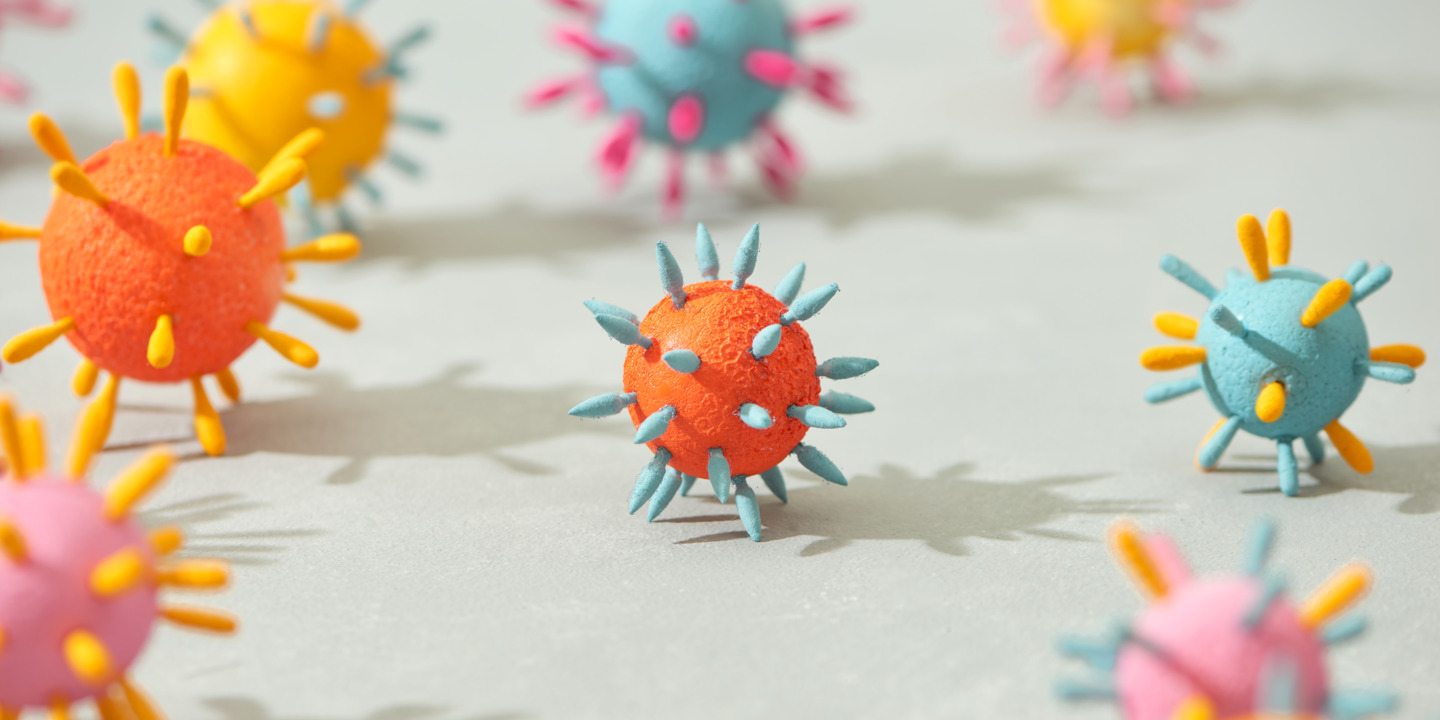
Worum genau geht es eigentlich beim Coronavirus?
Der offizielle Name des Virus lautet „SARS-CoV-2“, die Atemwegserkrankung, die es auslöst, wird als „COVID-19“ bezeichnet, kurz für Corona Virus Disease 2019. Man vermutet, dass die Erstübertragung von einem Tier auf einen Menschen erfolgte. Dieser sogenannte Wildtyp des Virus, der Ende 2019 das erste Mal in China von Mensch zu Mensch übertragen wurde, spielt inzwischen kaum noch eine Rolle. Dafür breiten sich immer neue Varianten des Virus aus.
Das liegt daran, dass bei jeder neuen Infektion die winzigen Viren millionen- bis milliardenfach kopiert werden. Bei solchen Kopiervorgängen kommt es immer wieder zu kleinen Fehlern. Manche dieser Fehler erweisen sich als Vorteil, durch die sich das Virus besser ausbreiten kann. So entwickelt sich der Krankheitserreger im Lauf der Zeit immer weiter.
Hauptübertragungsweg von Mensch zu Mensch ist die Tröpfcheninfektion, beispielsweise über Niesen oder Anhusten. Das funktioniert auch indirekt, zum Beispiel wenn die Tröpfchen über die Hände an Mund- und Nasenschleimhaut oder die Augenbindehaut gelangen. Darüber hinaus sind Übertragungen über Oberflächen, die kurz zuvor mit Viren kontaminiert wurden, per Schmierinfektionen möglich. Aufgrund der relativ geringen Stabilität von Coronaviren in der Umwelt ist dies aber nur in einem kurzen Zeitraum nach der Kontamination wahrscheinlich.
Wie schwer der individuelle Krankheitsverlauf sein kann, hängt dabei stark vom zunehmenden Alter und bestehenden Vorerkrankungen ab.
Modellrechnungen der OECD haben gezeigt, dass die soziale Distanzierung am Arbeitsplatz die wirksamste Methode ist, um die Infektionsrate zu mindern (23 bis 73 Prozent). Hinzu kommt die persönliche Distanzierung im privaten Bereich. Persönliche Hygiene kann die Infektionsrate um 27 Prozent reduzieren.
Die Inkubationszeit – der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen – beträgt meist ein bis 14 Tage. Im Durchschnitt sind es fünf bis sechs Tage.
Um Ihre Mitmenschen vor einer möglichen Ansteckung zu schützen, immer in die Armbeuge husten und niesen. So vermeiden Sie es, die Erreger über Ihre Hände weiterzuverbreiten. Eine spezifische Therapie gibt es noch nicht, im Zentrum der Behandlung stehen derzeit die optimalen unterstützenden Maßnahmen entsprechend der Schwere des Krankheitsbildes.
Die meisten Infizierten haben nur eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome. Bei etwa 15 von 100 Infizierten kann es zu schwereren Symptomen wie Atemproblemen oder einer Lungenentzündung kommen. Vor allem die folgenden Personengruppen haben ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe:
Entwickeln Sie Fieber, Husten oder Atemnot, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Er kann am besten einschätzen, welche Schritte nun erforderlich sind. Melden Sie sich auf jeden Fall vorab telefonisch an und schildern kurz, warum Sie eine Corona-Infektion vermuten.
Wenn bei Ihnen der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion besteht und der Arzt einen Test verordnet, übernimmt Ihre IKK classic die Kosten. Die Abrechnung erfolgt direkt über Ihre KV-Karte.
Standard ist in diesem Fall der sogenannte PCR-Test. Dabei werden mit einem Stäbchen Abstriche aus dem Rachen genommen, die man im Labor mit Hilfe spezieller Geräte auf Viren-Erbgut untersucht.
Eine Impfung ist in Ihrer hausärztlichen Praxis möglich. Die (Booster-)Impfung ist für Sie kostenlos.
Mehr zur Corona-ImpfungPatientinnen und Patienten können sich seit dem 07.12.2023 unter bestimmten Voraussetzungen wieder telefonisch krankschreiben lassen. Sollte eine persönliche Untersuchung bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt notwendig sein, nehmen Sie am besten vor Ihrem Arztbesuch telefonisch Kontakt zur Praxis auf und besprechen das weitere Vorgehen.
Tipp: Halten Sie bei Ihrem Anruf Ihre Gesundheitskarte bereit, damit das Praxisteam Ihre persönlichen Daten abgleichen kann.
Ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird von Ihrer Arztpraxis auf elektronischem Weg direkt an die IKK classic sowie Ihren Arbeitgeber übermittelt (eAU). Sie melden sich dann nur noch unverzüglich – wie bisher auch – bei Ihrem Arbeitgeber krank.
Stillen wird von der Nationalen Stillkommission weiterhin empfohlen: In der Muttermilch von infizierten Frauen wurden bislang keine COVID-19-Erreger nachgewiesen, weshalb es aktuell keine wissenschaftlichen Belege gibt, dass COVID-19 über die Muttermilch übertragen werden kann. Hauptrisikofaktor für eine Übertragung beim Stillen ist der enge Hautkontakt. Doch die Vorteile des Stillens überwiegen, so dass das Stillen unter Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen empfohlen wird.
Infizierte Mütter oder Verdachtsfälle sollten beim Stillen durch Hygienemaßnahmen wie gründliches Händewaschen vor und nach dem Kontakt mit dem Kind und durch das Tragen eines Mundschutzes eine Übertragung des Virus durch Tröpfcheninfektion verhindern.
Eine gute Übersicht rund um alle wichtigen Fragen gibt die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG).
Bislang gibt es noch keine genau auf das Virus abgestimmte Therapie.
Schwer erkrankte Patienten werden symptomatisch behandelt, z. B. mit fiebersenkenden Mitteln, mechanischer Beatmung oder der Therapie etwaiger bakterieller Zusatzinfektionen. In Einzelfällen werden auch antivirale Medikamente getestet.