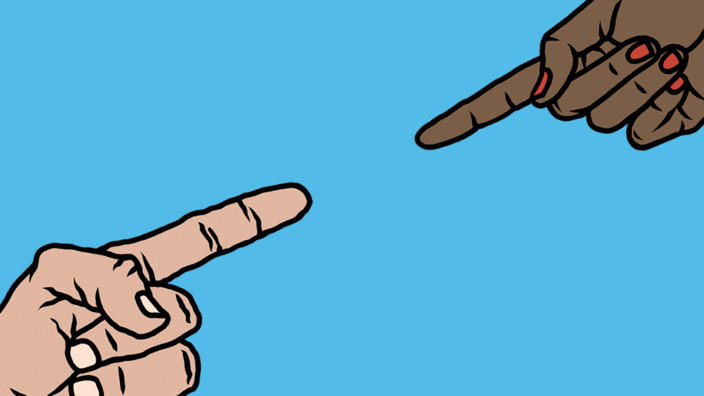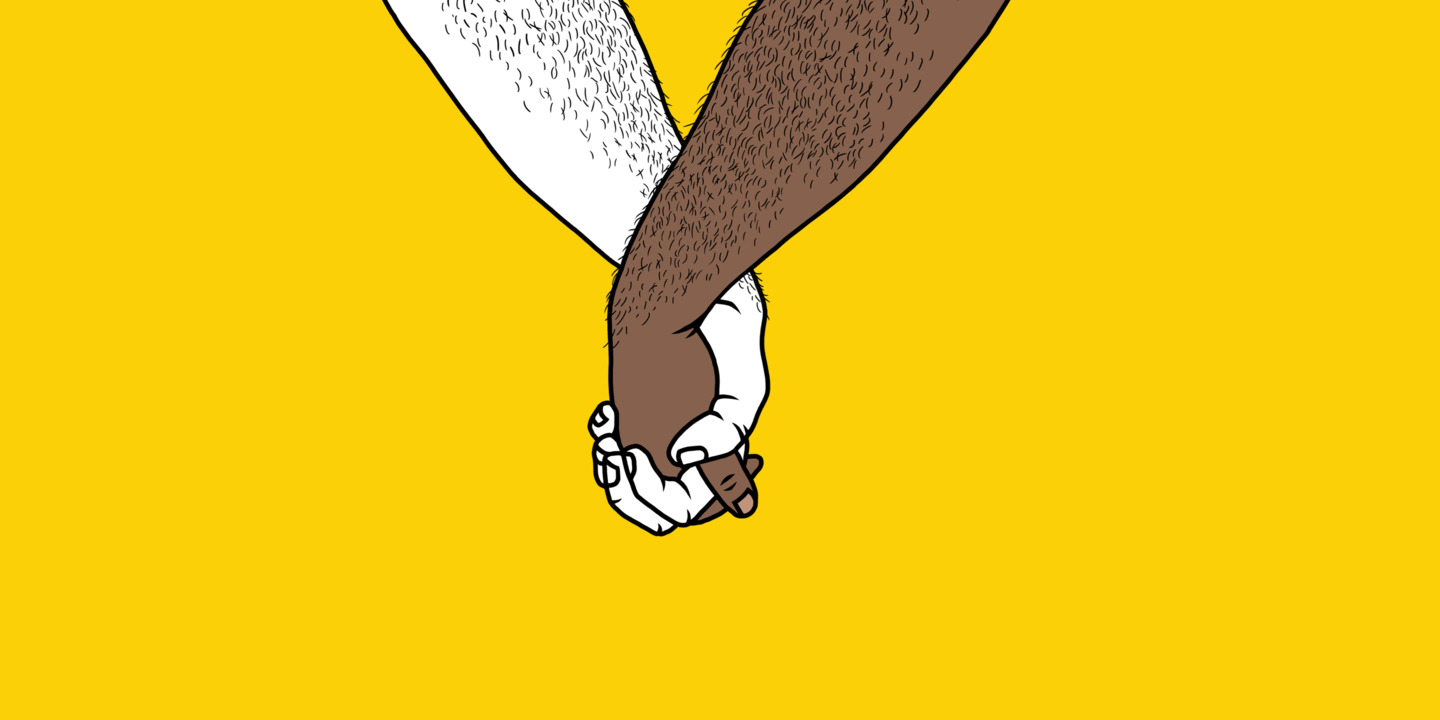
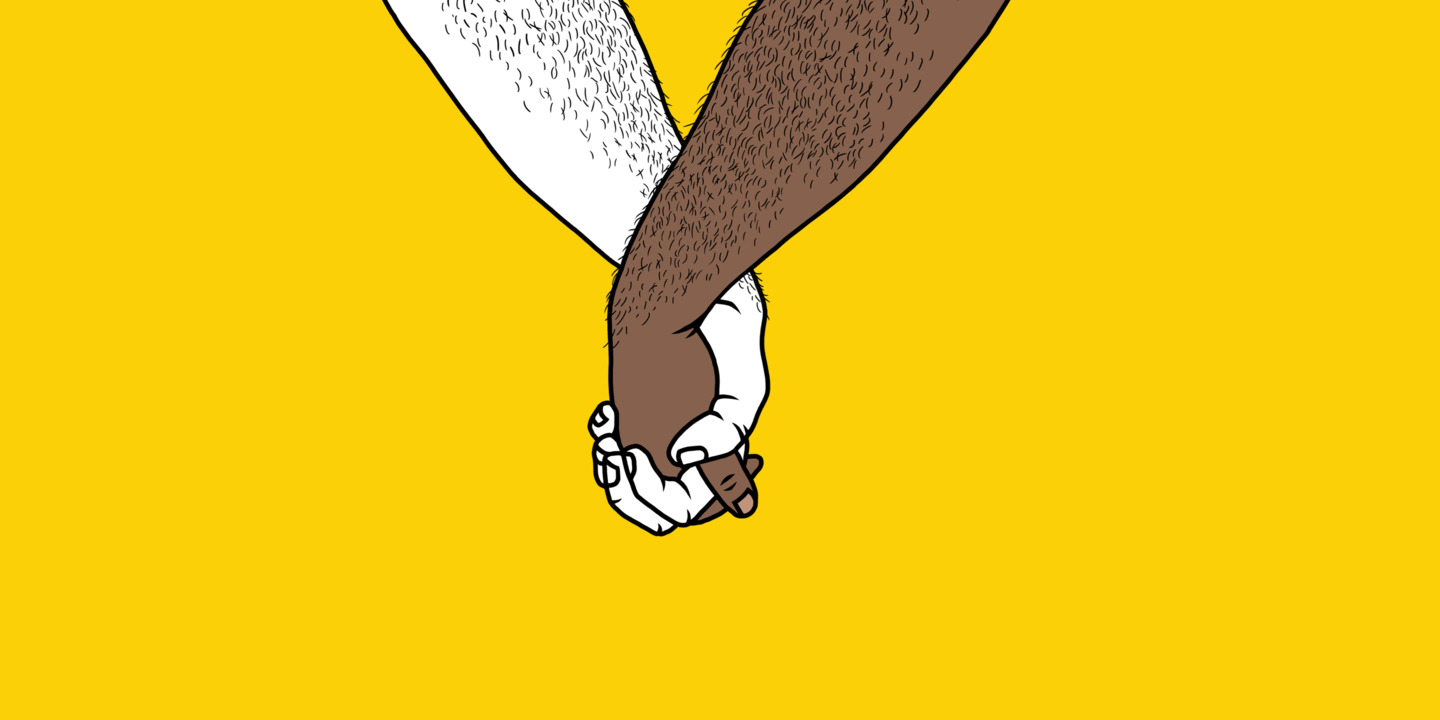
Menschen, deren sexuelle Identität vom angeborenen Geschlecht abweicht, oder Personen mit einer nicht-heterosexuellen Orientierung müssen oft gegen gesellschaftliches Halbwissen, Unwahrheiten und Ablehnung kämpfen. Doch Vorurteile führen zu Diskriminierung – und das kann krank machen.
Eigentlich scheinen wir auf einem guten Weg zu sein. Nach der Einführung der Ehe für alle im Oktober 2017 haben im folgenden Jahr 37.000 gleichgeschlechtliche Paare geheiratet, 2019 haben sich 52.000 gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland das Ja-Wort gegeben.
Auch die LGBTQIA+-Szene stößt auf immer mehr Zustimmung. Diese Abkürzung stammt aus dem Englischen und steht für: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer, intersexuell, asexuell). Mit dem Plus werden auch alle weiteren nicht binären Identitäten und nicht-heterosexuellen Orientierungen eingeschlossen. Über die Hälfte der Deutschen befürwortet die Einführung eines gesetzlich anerkannten dritten Geschlechts, das als divers bezeichnet wird. Auch das Wissen um die Möglichkeit von Geschlechtern, die sich nicht eindeutig in das binäre System "Mann" oder "Frau" einordnen lassen, verbreitet sich: Vom Begriff der Intersexualität haben 91 Prozent zumindest schon einmal gehört.
Und trotzdem fühlen sich viele Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Identität zur LGBTQIA+ Community zählen, oft nicht zugehörig – sie erleben Vorurteile und werden aus Gruppen ausgeschlossen: aus der Familie, dem Fußballverein oder der Öffentlichkeit.
Ich wollte einem alten Nachbarn wegen Corona mit den Einkäufen helfen.
...
Einem anderen Nachbarn sagte er, dass er nicht will, dass ein Schwuler ihm die Tüten trägt. Das hat mich schon getroffen.
Diskriminierung bei der Blutspende: Wir haben uns stark gemacht
Als gesetzliche Krankenkasse hat die IKK classic den Anspruch, allen Menschen ein gesundes Leben zu ermöglichen. Wertschätzung und ein Umgang auf Augenhöhe liegen uns besonders am Herzen. Deshalb haben wir uns mit der Initiative "Blut ist Blut" gegen die Diskriminierung von Männern, die Sex mit Männern haben, stark gemacht. Denn diese wurden noch bis 2023 bei der Blutspende diskriminiert.
Inzwischen wurde auch die Blutspende-Richtlinie überarbeitet und ist zum 4. September 2023 in Kraft getreten. In der überarbeiteten Richtlinie ist nun das persönliche Risikoverhalten, nicht die sexuelle Orientierung maßgeblich für eine Blutspende.